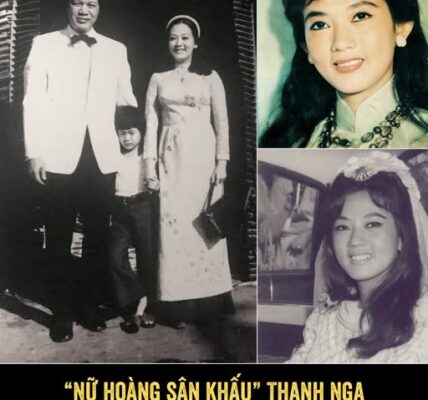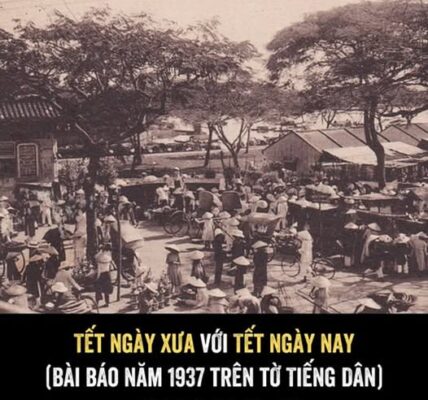Stalingrad 1943 – Ein deutscher Soldat schreibt seinen letzten Brief nach Hause. Zwischen Schutt, Kälte und Hoffnung schreibt er nicht über den Krieg, sondern über das Leben, das er vermisst.H
Es ist Winter in Stalingrad. Der Schnee fällt leise über eine zerstörte Stadt, die zu einem Massengrab geworden ist. Zwischen Trümmern, Rauch und Kälte sitzt ein Mann – ein deutscher Soldat. Er ist jung, vielleicht 22 oder 23 Jahre alt. Sein Mantel ist zerrissen, seine Hände zittern vor Frost. In seinem Schoß liegt ein kleines Stück Papier. Er schreibt.

Sein Helm liegt neben ihm, das Gewehr lehnt an der Wand. Für einen Moment scheint der Krieg weit weg zu sein. Nur das Kratzen des Bleistifts auf dem Papier durchbricht die Stille. Er schreibt nicht über den Kampf, nicht über Befehle oder Siege – er schreibt über Zuhause.
„Liebe Mutter, lieber Vater,“ beginnt er. „Mir geht es gut, soweit man das hier sagen kann…“
Er weiß, dass das nicht stimmt. Er weiß, dass der Hunger ihn langsam aufzehrt, dass die Kälte sich in seine Knochen frisst. Aber er will seine Familie nicht belasten. Er will ihnen Hoffnung geben, auch wenn er selbst längst keine mehr hat.
Draußen hört man das dumpfe Donnern der Geschütze. Der Himmel ist schwarz von Rauch. Doch in dieser Ecke der Ruinen, in diesem kurzen Augenblick, existiert nur er und der Brief.
Vielleicht schreibt er von seinem kleinen Bruder, der zu Hause Schlitten fährt. Oder von dem Mädchen, das ihm versprochen hat zu warten. Vielleicht schreibt er nur, um sich selbst daran zu erinnern, dass es irgendwo noch Leben gibt, jenseits dieser Hölle.
Stalingrad – der Ort, an dem Hunderttausende Männer gefangen sind. Ohne Nahrung, ohne Hoffnung, umzingelt von einer Kälte, die selbst die Seele erfrieren lässt. Die Front ist zusammengebrochen. Die Versorgung ist abgeschnitten. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben.
Der Soldat weiß, dass dieser Brief wahrscheinlich nie ankommen wird. Die Postwege sind zerstört, viele Briefe enden im Schnee, im Feuer, im Blut. Aber er schreibt trotzdem. Denn Schreiben bedeutet, noch Mensch zu sein.
Seine Finger sind wund, die Tinte gefriert fast auf dem Papier. Er hält inne, schaut auf das, was er geschrieben hat. Dann fügt er eine letzte Zeile hinzu:
„Macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin nicht allein.“
Er lügt. Er ist allein. Um ihn herum liegen die Schatten seiner Kameraden – Männer, die einst lachten, sangen, träumten. Jetzt sind sie still. Nur der Wind trägt ihre Geschichten davon.
Er faltet den Brief, steckt ihn in die Brusttasche seiner Uniform. Vielleicht hofft er, dass jemand ihn eines Tages finden wird. Vielleicht denkt er gar nicht daran – vielleicht will er nur festhalten, was ihm bleibt: Worte.
Ein Feldgeistlicher kommt vorbei, segnet die Verwundeten. Ein Offizier ruft Befehle, aber die Stimmen klingen fern. Der Soldat bleibt still sitzen, die Augen geschlossen, den Kopf an die Wand gelehnt.
Er denkt an Zuhause. An das Geräusch von Regen auf dem Dach. An den Geruch von Brot. An das Lachen seiner Mutter. In diesen Gedanken fin